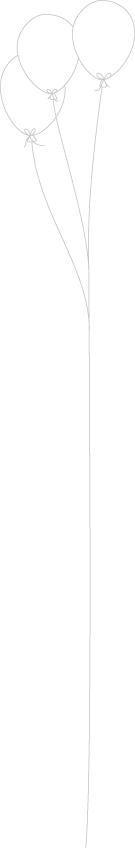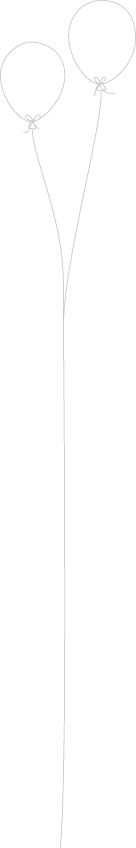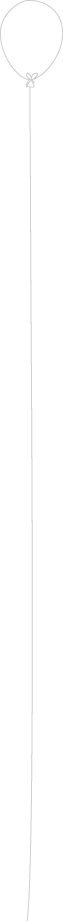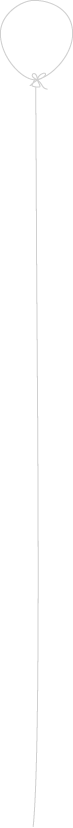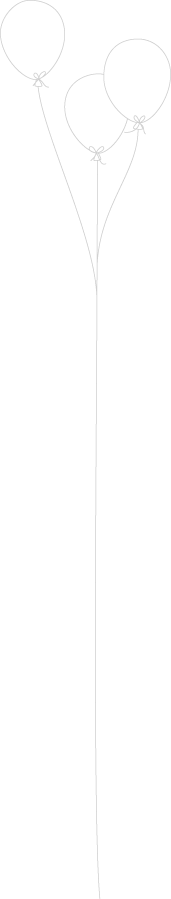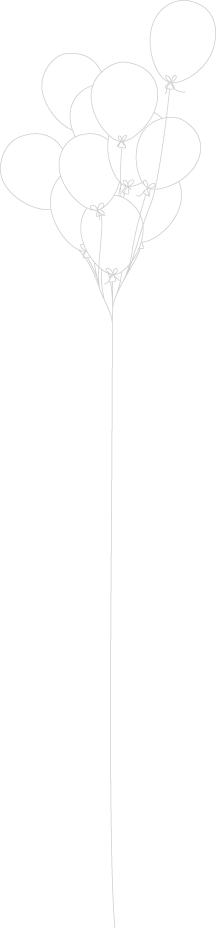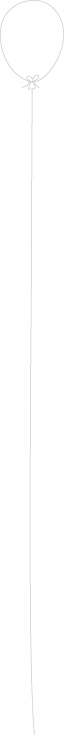Warum zehn Jahre hormonelle Verhütung für mich (!) genug sind.

Quelle: flickr.com/nerdycreative
Eines vorneweg: Es geht mir hier nicht darum, irgendjemandem die Einnahme der Pille verbieten zu wollen. Es geht darum, dass jeder Mensch die Wahlfreiheit haben sollte, ob er die Risiken hormoneller Verhütung in Kauf nehmen möchte oder nicht.
Wie so oft fing alles mit einer WG-Debatte an. „Weißt du eigentlich, was du deinem Körper damit antust?“, warf mir meine griechische Mitbewohnerin eines Abends in der Küche an den Kopf. Gerade hatte ich erzählt, dass ich nun im zehnten Jahr die Anti-Baby-Pille nehme bzw. hormonell verhüte. Im Verlaufe des Gesprächs realisierte ich, auf was sie mich eigentlich aufmerksam machen wollte. Die hierzulande und auch in den skandinavischen Ländern so gängige Routine, Mädchen ab der ersten Periode die Pille zu verschreiben existiert in vielen anderen Ländern so nicht. In Griechenland, so berichtete meine Mitbewohnerin, seien Zyklusbeobachtung oder die Verwendung von Kondomen bei Heterokontakten wesentlich gängiger, die Pille würde nur bei zusätzlichen medizinischen Indikationen verschrieben. Ob ihre Schilderung sich nun empirischen belegen lässt oder nicht unser leichtfertiger Umgang mit diesem Medikament erscheint mir auch heute, ein Jahr nach diesem Gespräch, mehr als fragwürdig.
Ja, ich bin medizinische Laiin. Trotzdem maße ich mir an, in Frage zu stellen, warum der erste Gynäkologenbesuch bei den meisten Menschen (Quelle: Freundeskreis) zwangsläufig mit einem Pillenrezept enden muss. Damit die Pickel verschwinden. Damit der Zyklus regelmäßiger wird. Damit die Regelschmerzen besser werden. Nicht, dass das in der Pubertät normale Phänomene wären. Gerade weil die Pille für uns (=in Deutschland aufgewachsene Menschen) vollkommen zur Normalität gehört, vergessen wir oft, dass wir es hier mit einem ernstzunehmenden Medikament zu tun haben, das einen ernsthaften Eingriff in uns und unseren Körper bedeutet. Und auch die großen Pharmakonzerne tragen natürlich ihren Teil dazu bei, dass kritische Berichterstattung zur Anti-Baby-Pille in Deutschlands Medien kaum abgehandelt wird. So ist hierzulande kaum bekannt:
Und dem (deutschen) Hersteller fällt nichts besseres ein, als zu beteuern, dass man nach wie vor hinter seinen Produkten stehe.
Während Pillenkritik sich im deutschsprachigen Raum hauptsächlich im feministischen Milieu findet, hat sich in Schweden Anfang des Jahres ein kleiner aber feiner medialer Diskurs zum kritischen Umgang mit der Anti-Baby-Pille entwickelt. Ausgelöst wurde die Aktion namens „Nej tack till p-piller som gör oss sjuka“ (Nein danke zu Anti-Baby-Pillen, die uns krank machen) von jungen Aktivistinnen, die vorallem auch auf die alltäglichen Nebenwirkungen der Medikamente aufmerksam machen wollen. Selbst eine Sprecherin der schwedischen Arzneimitelbehöde gab daraufhin im Gespräch zu, dass ein Großteil der hormonell verhütenden Frauen unter schwacher Libido und viele auch unter depressiven Verstimmungen litten (ähnliche Symptome führten ironischerweise zum unmittelbaren Abbruch von klinischen Untersuchungen zur „Pille für den Mann„).
Schauen wir uns die Thematik mal aus einer Genderperspektive an. Verhütung wird in großen Teilen der heterosexuellen deutschen Gesellschaft nach wie vor als Frauen*thema verstanden. Das lässt sich auch daran ablesen, dass die Pille in Deutschland das gängigste Verhütungsmittel ist. Die Frau* hat (passiv) dafür zu sorgen, dass sie nicht schwanger wird. Die Forschung zur Pille für den Mann* wurde vor zwei Jahren wieder auf Eis gelegt (siehe auch oben) – zumindest in festen, monogamen heterosexuellen Beziehungen bleibt Verhütung vorerst also auch Frauen*sache. Ja, auch Männer* kümmern sich mal darum, dass Kondome verfügbar sind. Die oben genannten Risiken und Nebenwirkungen betreffen aber nicht ihren Körper. Aus einer Gendersicht interessant ist übrigens vor allem, dass eine der häufigsten Nebenwirkungen der Pille eine abgeschwächte Libido ist – das kennt wahrscheinlich jedermensch, der sie schon einmal genommen hat. Darüberhinaus legen verschiedene Studien nahe, dass sie auch zum (zeitweisen) Verlust der Orgasmusfähigkeit führen kann. Trotzdem spricht darüber kaum jemand und diese Art der Nebenwirkung findet, meiner Meinung nach, völlig unzureichende Beachtung. Die Regulierung des sexuellen Verlangens dieser Menschen wird schweigend in Kauf genommen, während sie sich dann im deutschen Fernsehen Witze über „ständige Migräne/Unlust“ anhören müssen. Schlimmer noch. Nimmt man, wie ich, seit seiner frühsten Jugend die Pille kann sich, angenommen die Nebenwirkung tritt auf, auch keine unbeeinflusste Libido herausbilden. Das kommt in einem Land, in dem von Mädchen* nach wie vor sexuelle Zurückhaltung verlangt wird, natürlich auch nicht ungelegen. Ist die Libido also vom ersten Erwachen bis zur letzten Einnahme der Pille quasi hormonell reguliert, bemerken viele Frauen auch garnicht, dass sie eine verminderte sexuelle Lust haben, sie kennen es ja nur so. Und all das wird uns dann in der Packungsbeilage als seltene, weniger gravierende Nebenwirkung verkauft (obwohl medizinische Untersuchungen anderes sagen). Es geht hier also nicht nur um das Risiko für jede einzelne Frau, es geht auch um das System, dass auf heterosexuelle Frauen einen enorm hohen Druck ausübt, die Pille zu nehmen und sich mit den Nebenwirkungen abzufinden, während junge heterosexuelle Männer kein medizinisches Risiko auf sich nehmen müssen.
Wie man sicher ohne große Anstregung aus diesen Zeilen herauslesen kann: Ich habe es satt. Sowas von. Ich habe es satt, dass alle von mir erwarten, die Pille zu nehmen. Ich habe es satt, dass mich meine Ärzte*innen nicht über die Risiken aufklären und nicht fragen, ob ich Risikopatientin bin. Ich habe es satt, dass ich nicht ausreichend über Alternativen aufgeklärt werde. Ich sehe nicht länger ein, warum ich mich und meinen Körper diesen Strapazen weiter aussetzen soll. Für mich ist die Pille keine Befreiung, für mich ist sie eine Pflicht und ein Risiko. Und es gibt andere Wege. Seit über 30 Jahren untersucht die Universität Heidelberg die sogenannte sensiplan Methode. Eine Methode zur Zyklusbeobachtung (Temperatur + Schleim + Muttermund), die richtig angewendet ähnlich sicher wie die Pille ist. Ja, auch diese Methode erfordert das Engagement der Frau. Die „Arbeit“ & Verantwortung kann aber wesentlich besser aufgeteilt werden und medizinische Risiken gibt es quasi keine. Die meisten Gynäkologen verdrehen darauf angesprochen zwar nur die Augen – das kann man zumindest in vielen Foren nachlesen – aber ich werde mich dem Diktat der Pille keinen Zyklus länger beugen. Nein danke, zu Pillen, die uns krank machen!